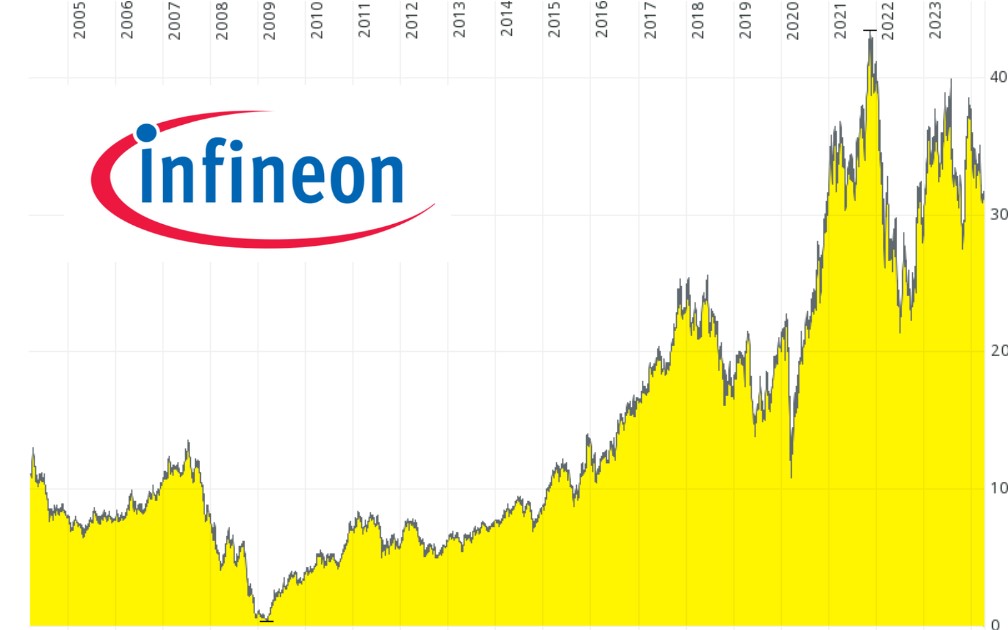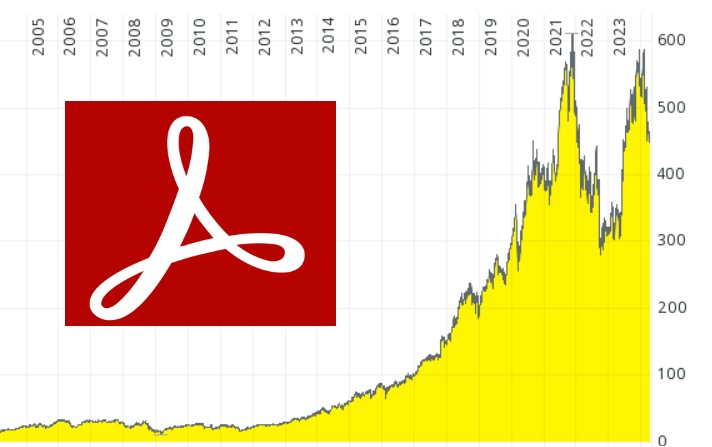Aktienrückkäufe sind hierzulande inzwischen weit verbreitet, wie wir aus den Publikationen, Rechenschaftsberichten, Prognosen etc. der Unternehmen entnehmen können. Dennoch spielen Dividenden in Deutschland für Anleger nach wie vor eine größere Rolle. In den USA, überhaupt im anglo-amerikanischen Raum ist das auf Grund einer anderen Aktienkultur anders. Dort sind Aktienrückkäufe mit Blick auf die gesamten Ausschüttungen genauso relevant wie Dividenden. US-Konzerne sind führend bei den Aktienrückkäufen.
Ein Unternehmen entscheidet sich zum ersten Mal Aktien auszugeben und an die Börse zu gehen. Warum tut es das? Das Unternehmen gibt Aktien aus, um Geld von Investoren einzusammeln und beteiligt diese im Gegenzug dafür am Unternehmen und dessen Gewinn. Das dadurch eingesammelte Geld wird auch als Eigenkapital bezeichnet.
Beim Aktienrückkauf (englisch: buyback) wiederum passiert dann das genaue Gegenteil. Unternehmen können sich auch dazu entscheiden, Aktien vom Markt wieder zurückzukaufen und somit die Anzahl der handelbaren Anteile zu reduzieren. Dadurch wird das Eigenkapital verringert. Das Unternehmen muss schließlich Kapital dafür aufwenden, um die Aktien von seinen Investoren zu kaufen.
Der Vorstand eines Unternehmens oder der Aufsichtsrat kann einen Aktienrückkauf nicht einfach eigenmächtig initiieren. Dieser muss durch die Hauptversammlung, also den Aktionären, genehmigt werden. Nur wenn die Hauptversammlung den Aktienrückkauf beschlossen hat, darf das Unternehmen Aktien zurückkaufen. Dabei kann die Gesellschaft ein Rückkaufprogramm beschließen, in dem Aktien im Volumen von maximal zehn Prozent des Grundkapitals über maximal 5 Jahre zurückgekauft werden können. Um nicht jedes Mal eine kostenintensive Hauptversammlung einzuberufen, lassen sich viele Unternehmen von der Hauptversammlung Aktienrückkäufe in einem sogenannten Vorratsbeschluss genehmigen. Das bedeutet, die Firma bekommt einen Rahmen genehmigt, innerhalb dessen sie Aktien zurückkaufen darf. Ob der Rückkauf dann überhaupt stattfindet und wann er geschieht, entscheidet wiederum der Vorstand. Denn manchmal haben die Unternehmen andere strategische Optionen und die Option des Aktienrückkaufs ist hinfällig oder wird nicht in voller Höhe durchgezogen.
Für die Unternehmen gibt es nun zwei Möglichkeiten seine Aktien zurückzukaufen. Über die Börse kauft eine Gesellschaft über einen gewissen Zeitraum Stück für Stück Aktien ein. Werden diese hingegen direkt von den Aktionären zurückgekauft, unterbreitet das Unternehmen den Aktionären ein öffentliches Kaufangebot. Die Aktionäre erhalten dann eine Mitteilung über ihren Broker (mit Fristbindung) und können dann entscheiden, ob sie auf das Angebot eingehen oder nicht. Die Aktien sind im Depot des jeweiligen Anteilseigners und damit im Eigentum des Aktionärs und damit entscheidet der Aktionär trotz des Beschlusses der Hauptversammlung selbst, ob er das Angebot annimmt oder nicht.
Das Unternehmen kann die zurückgekauften Aktien entweder “einziehen”, also vernichten. Oder diese werden verwahrt, um beispielsweise zu einem späteren Zeitpunkt wieder verkauft oder als Finanzierungsmittel für einen Übernahmepoker ins Spiel gebracht zu werden. Letzteres ist bei Übernahmen gar nicht so selten.
Nur warum werden Aktienrückkäufe überhaupt getätigt? Das Unternehmen entscheidet sich in der Regel dann für Aktienrückkäufe, wenn es einige Jahre hoher Gewinne und die Gesellschaft dadurch eine stabile “finanzielle Gesundheit” hat. Denn Fakt ist, für die Programme werden hohe Cash-Mittel verbraucht. Über den Zeitpunkt, wann sich Unternehmen zu Aktienrückkäufen entscheiden, lässt sich nur schwer eine Prognose treffen. In der Regel glaubt das Unternehmen, dass die eigene Aktie unterbewertet ist und erwartet einen Gewinn in der Zukunft, wenn es sich zu Aktienrückkäufen entschließt. Schauen wir uns im Folgenden die Gründe genauer an:
Wenn Fremdkapital günstiger ist als Eigenkapital, kann durch Aktienrückkäufe Eigenkapital in Fremdkapital umgewandelt werden. Als Fremdkapital bezeichnet man in der Regel Schulden. Für diese müssen Unternehmen Zinsen bezahlen und diese machen die Fremdkapitalkosten aus.
Sammelt ein Unternehmen von Investoren Eigenkapital ein und gibt dafür Firmenanteile aus, erwarten die Aktionäre, dass diese mit ihrer Investition ein Risiko eingehen und dafür eine entsprechende Rendite erhalten. Zum einen erwarten diese also Dividende – je mehr Anteile ein Unternehmen herausgibt, desto mehr Dividende muss dieses also ausschütten. Und zum anderen wird natürlich auch ein Kursgewinn erwartet, sodass die Aktien unter Umständen leicht günstiger als der eigentliche Unternehmenswert gekauft werden und damit höhere Kursgewinne erzielt werden können, wenn das Unternehmen die Märkte überzeugt.
Ein Unternehmen kann sich nun also entscheiden freie Mittel für Aktienrückkäufe zu verwenden. Ein Problem könnte dabei bestehen: Dieses Geld fehlt dann möglicherweise an einer anderen Stelle für eine Investition. Sind die Zinsen entsprechend niedrig, wie sich in der Vergangenheit entwickelten, ist es aber aus Sicht des Vorstandes wirtschaftlicher, sich diese fehlende Liquidität zu leihen, also das Fremdkapital zu erhöhen. So würde Eigenkapital durch Fremdkapital ersetzt werden.